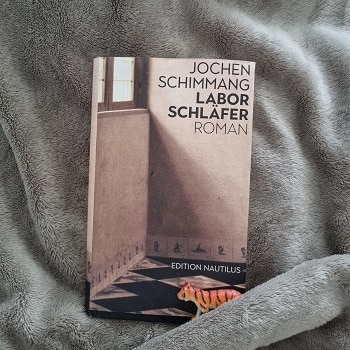 Reiner Roloff ist Laborschläfer: Der studierte Soziologe mit gebrochener Erwerbsbiografie ist fast so alt wie die BRD und nimmt an einer Langzeitstudie zum Einfluss des Schlafs auf das Erinnern teil. Es ist also ein Roman des Zurückblickens, aber gewissermaßen auch des Sich-Findens. Jochen Schimmangs Laborschläfer ist auch ein Text, der sich ob seines Gegenstandes wenig überraschend mäandernd und voller Ruhe liest.
Reiner Roloff ist Laborschläfer: Der studierte Soziologe mit gebrochener Erwerbsbiografie ist fast so alt wie die BRD und nimmt an einer Langzeitstudie zum Einfluss des Schlafs auf das Erinnern teil. Es ist also ein Roman des Zurückblickens, aber gewissermaßen auch des Sich-Findens. Jochen Schimmangs Laborschläfer ist auch ein Text, der sich ob seines Gegenstandes wenig überraschend mäandernd und voller Ruhe liest.
“Mein Gedächtnis scheint ein unzerstörbarer Bunker zu sein, in dem fast der ganze Unrat meines Lebens gelagert wird” (9). Die Zeilen aus der ersten Seite des Romans kann der Leser durchaus als Warnung lesen. Denn Laborschläfer findet zu großen Teilen in den Erinnerungen des Protagonisten statt, die, episodenhaft und wiederkehrend, nicht unbedingt einen starken Plot bilden, der durch den Text führt. Die Gegenwart des Textes befasst sich überwiegend mit den Erlebnissen im Schlaflabor, welches von dem zusehends erratischen Dr. Meissner geführt wird, der an dem Zusammenhang von Schlaf, Erinnerung und kollektivem Gedächtnis interessiert ist. Diese Gegenwart ist übrigens auch die Zeit der Pandemie, die trotz allen Erregungspotenzials ja auch eine Zeit der Ruhe, des Erinnerns war/ist, aber in diesem Text vordergründig keine große Rolle einnimmt.
Reiner Roloff wurde, wie auch Jochen Schimmang, kurze Zeit nach Ende des 2. Weltkriegs geboren. Er erinnert sich an ein zerbombtes Köln, das Spielen in Trümmern. Wenngleich seine Erinnerungen detailliert und wenig trümmerhaft sind, so ist es durchaus seine Biografie: Er ist diplomierter Soziologe, nahm in seinem Fachbereich aber nie einen Brotberuf an und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Abgesehen von dieser brüchigen Erwerbsbiografie lesen wir von einer späten ersten Liebe, Bekanntschaften und Erinnerungen aus der Nachkriegsgeschichte der BRD – hier immer wieder eine Auseinandersetzung mit dem Schweigen, dem trümmerhaften Aufarbeiten der Elterngeneration an den Verbrechen ihrer Zeit.
Oftmals stehen diese Bruchstücke eines Lebens und westdeutscher Geschichte etwas losgelöst nebeneinander. Sie kohärieren im Text nicht zu einer Handlung, wohl aber zu einem Interesse und der Frage nach dem schwer zu greifenden kollektiven Gedächtnis. Und dieses kann hier auch nur westdeutsch begriffen werden, da hier einer erzählt, der die Wende eher mit Befremden wahrnahm. Der Gedanke an heute, vor allem in Bezug auf die Pandemie, die neben einander her, in verschiedenen Milieus lebenden Generationen, führt zu interessanten Fragen: “Können wir uns nicht nur darüber verständigen, was damals war, sondern auch darüber, wie es war (115)? Ist nicht nur das Ereignis an sich, sondern auch dessen Interpretation bzw. Wahrnehmung entscheidend für ein kollektives Gedächtnis? Oder ist diese Gesellschaft zu zertrümmert?
Solche Überlegungen mögen etwas für sich haben, aus ihnen wächst jedoch nicht zwingend ein gelungener literarischer Text. Als ostdeutscher Leser fühlt man sich hier ohne Bezug, stößt sich eher an einer unterschwelligen Ablehnung. Schiebt man dies beiseite, hat der Text dennoch Schwierigkeiten, den Leser bei der Stange zu halten. Kopflastig, stilistisch wenig aufregend, entfalten sich Erinnerungen aus einem Leben, das streng genommen vor sich hin plätscherte. Und so entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, das dieser Text mich regelmäßig so schläfrig machte, dass es einen Monat brauchte, um ihn auszulesen.
*
Laborschläfer ist bei Edition Nautilus erschienen.
Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.