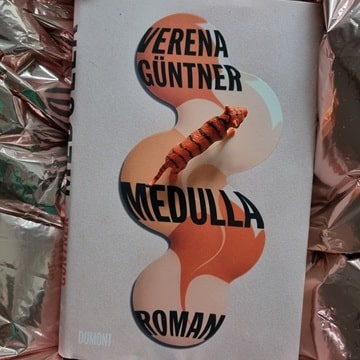 „Medulla“ bedeutet wörtlich Mark – zumindest im medizinischen Bereich. Symbolisch betrachtet referenziert es das Innerste oder das Wesentliche oder einfach das Selbst. Verena Günthers Roman Medulla schärft das Verständnis des Begriffs nicht zwingend. Man kann aber festhalten, dass die sechs Personen, die sie porträtiert, sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ihre Innerlichkeit, ihr Kern, wird dennoch selten scharf – vielleicht liegt es am Umbruch, in dem sie sich befinden. Vielleicht liegt da aber auch der Kern der Krisen, denen Lesende hier beiwohnen.
„Medulla“ bedeutet wörtlich Mark – zumindest im medizinischen Bereich. Symbolisch betrachtet referenziert es das Innerste oder das Wesentliche oder einfach das Selbst. Verena Günthers Roman Medulla schärft das Verständnis des Begriffs nicht zwingend. Man kann aber festhalten, dass die sechs Personen, die sie porträtiert, sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ihre Innerlichkeit, ihr Kern, wird dennoch selten scharf – vielleicht liegt es am Umbruch, in dem sie sich befinden. Vielleicht liegt da aber auch der Kern der Krisen, denen Lesende hier beiwohnen.
Medulla ist in drei Teile gegliedert, jeder davon begleitet ein Berliner Pärchen im Moment des Zerfalls. Das Thema Nachwuchs ist gewissermaßen jeweils die Sollbruchstelle dieser Beziehungen – vor allem aber die Einstellungen, die die drei Frauen, jeweils auch Hauptpersonen der jeweiligen Sequenz, zum Thema Kinder und Familie einnehmen.
Die Dinge sind beim ersten Paar, Jan und Siv, eigentlich klar: Wir lernen die beiden kennen, als er seinen 50. Geburtstag feiert – im Restaurant, das ihm gehört. Er ist gut situiert, so sehr, dass er eigentlich kaum noch einen Finger im Restaurant krumm machen muss. Das Geschäft läuft auch ohne ihn, finanziell ist er mit einer schicken Eigentumswohnung abgesichert. Siv lebt bei ihm und hat im Sinne einer eigenen Karriere wenig vorzuzeigen. Sie produziert Musik und legt gelegentlich auf – nichts davon erfolgreich. Aber das muss sie dank ihrer Partnerschaft finanziell gesehen auch nicht. Darüber hinaus genießt sie die Freiheit: Sie verbringt viel Zeit bei ihrer Freundin Hanna, mit der sie Sex hat, und später auch mit Hannas Freund Hans, mit dem sie ebenfalls Sex hat. Kinder kommen für sie nicht infrage – sie hatte nie das Bedürfnis, Mutter zu werden. Das wusste auch Jan. Doch als sie dann doch schwanger ist, hadert er damit – sie nicht. Es wird unschön.
Layla und David scheinen in einer anderen Situation: Das Paar hat es jahrelang versucht, doch trotz Fruchtbarkeitsklinik ohne Erfolg. Nun ist es unverhofft doch passiert – Layla ist schwanger. Und erst jetzt fällt ihr auf: Eigentlich will sie nicht Mutter sein. Bei Esther ist die Frage nach dem „Ob“ bereits gelaufen – sie ist im achten Monat schwanger, beschäftigt sich aber lieber mit ihrer Arbeit in einer NGO und einer sich anbahnenden Affäre.
Diese drei Geschichten sind verwoben – die Pärchen sind miteinander bekannt. Layla und Esther sind Kolleginnen, die sich nicht zwingend unterstützend gegenüberstehen. David hatte einmal etwas mit Siv. Man trifft sich auch bei Dinnerpartys, die Verena Günther immer herrlich schiefgehen lässt – überwiegend, weil die tendenziell hilflosen Männer ihres Romans sich hoffnungslos betrinken.
Es sind seltsame Beziehungen, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Lieblosigkeit regiert. Warum diese Menschen überhaupt in Beziehungen sind, wird nicht so richtig präsent – scheinbar sind diese Partnerschaften einfach so passiert, und aus Bequemlichkeit ist man dabei geblieben. Während das Arrangement bei Jan und Siv zuerst zu funktionieren scheint, weiß man bei den anderen beiden nicht, was diese Menschen aneinander hält. So wohnt Layla zwar mit David zusammen, hat aber ihre alte Einzimmerwohnung behalten. Sie schafft es auch nicht, ihn zu seinen Eltern ins Hospiz zu begleiten. Vielleicht ist das auch symptomatisch für die Zeit und den spezifischen Ort (Berlin): Verbindlichkeit ist ob der vielen Möglichkeiten etwas, das als erdrückend oder überfordernd wahrgenommen wird.
Spätestens ab der Mitte von Medulla wird der Text ermüdend und erschöpft sich im dritten Teil völlig: So erfrischend wie der Roman beginnt, so überraschungsarm ist sein Verlauf. Zwar beginnt jeder Teil mit unterschiedlicher Ausgangslage, folgt dann aber der gleichen Bewegung des vorherigen.
Ja, die drei verwobenen Handlungen von Medulla können als Befreiungsschlag gegen gesellschaftliche Normen gelesen werden und sind ein Plädoyer für das Selbstbestimmungsrecht der Frau – als solches ist der Text ein wertvoller Beitrag zu einer Selbstverständlichkeit, die immer wieder von konservativen Kräften bezweifelt wird. Doch Günther exerziert diese Ideen dreimal hintereinander ohne nennenswerte Kontrastpunkte. Das ist radikal und mutig und eindringlich – aber im gesamten Textumfang auch ein bisschen overkill.
*
Medulla von Verena Günther ist bei Dumont erschienen.
Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.