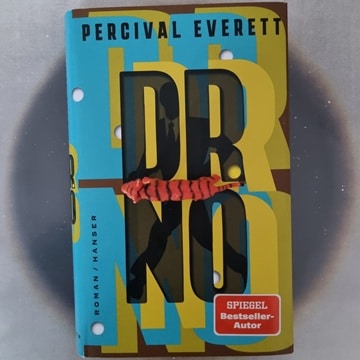 Percival Everett hat einen Lauf: War er schon immer ein guter und produktiver Autor von Romanen und Erzählungen, hat er es mit seinem letzten Roman James auf den Olymp geschafft. Sowohl der National Book Award als auch der Pulitzer Prize gingen an ihn. Er hat sich viel getraut und alles gewonnen: eine Re-Imagination von Twains uramerikanischem Roman Huckleberry Finn aus Sicht des Sklaven Jim. Vorher hatte er mit Die Bäume einen satirischen Crime Novel geschrieben, und nun folgt mit Dr. No ein absurder wie komischer Thriller, der sich nicht nur im Titel bei James Bond bedient.
Percival Everett hat einen Lauf: War er schon immer ein guter und produktiver Autor von Romanen und Erzählungen, hat er es mit seinem letzten Roman James auf den Olymp geschafft. Sowohl der National Book Award als auch der Pulitzer Prize gingen an ihn. Er hat sich viel getraut und alles gewonnen: eine Re-Imagination von Twains uramerikanischem Roman Huckleberry Finn aus Sicht des Sklaven Jim. Vorher hatte er mit Die Bäume einen satirischen Crime Novel geschrieben, und nun folgt mit Dr. No ein absurder wie komischer Thriller, der sich nicht nur im Titel bei James Bond bedient.
Professor Wala Kitu ist Experte für nichts, das Nichts – um es möglichst präzise und unscharf zugleich auszudrücken. Er ist Mathematiker und, wie seine Kollegin und Freundin Eigen Vector, auf dem autistischen Spektrum. Ein Milliardär mit dem Namen John Sill tritt an ihn heran, weil er sich für nichts interessiert – tatsächlich vermutet er in Fort Knox eine Schuhschachtel, die nichts enthält und die entscheidende Waffe ist, um Amerika auszulöschen oder die Weltherrschaft zu erlangen – so glaubt er zumindest. Er gibt dem Professor drei Millionen Dollar für seine Dienste als Berater. An Eigen Vector findet er ebenfalls Interesse und nimmt sie mit auf die abenteuerliche Odyssee, die sich auf den Folgeseiten entspinnt.
John Sill ist ein Bond-typischer Schurke – megalomanisch und marottenhaft. Und natürlich interessiert sich auch die Regierung für ihn und seine rätselhaften Pläne und wozu er dafür einen Experten für nichts braucht. Zwei Agenten haften sich an Wala Kitus Fersen, der sein Engagement mit einer gewissen Neugier und gleichzeitig unbedarft hinnimmt. Dass John Sill nicht gelogen hat, als er sich als Schurke bezeichnete, erkennt er erst, als es zu spät ist. Er mag ein Spinner sein – aber er ist eben auch ein Milliardär mit sinistren Absichten.
Erzählt wird Dr. No aus der Perspektive des Professors. Aufgrund seines Asperger-Syndroms ist seine Erzählweise eigentümlich und voller situativer Komik; besonders die nüchterne Dialogführung in anzüglichen oder hochgefährlichen Situationen unterhält ebenso wie die allgegenwärtigen „nichts“-Wortspiele.
Diese Tour de Force ist albern, aber auch ernst. Everett ist ein erfahrener wie kluger Autor, der es versteht, dass Lesende nicht in unzugänglichen Gedankengefängnissen, die sich als Literatur tarnen, gefangengenommen werden wollen. Er dosiert die Mathematikexkurse so, dass man nicht aussteigt. Mathematikfans werden ihre Freude an den zahlreichen Anspielungen haben. Andere können sich zum Philosophieren eingeladen fühlen. Zuletzt schaffte es der verstorbene Großmeister Cormac McCarthy, literarische Mathematik mit Philosophie so einnehmend zu verknüpfen – wenngleich in einem völlig anderen Register. Dr. No liest sich ein bisschen wie eine Pulp Fiction, verknüpft die Unterhaltungsliteratur mit literarischer Ambition wie andere Meister der amerikanischen Postmoderne – ich denke hier beispielsweise an den frühen Don DeLillo.
Dr. No ist ein Roman über Rache und Macht und das große gähnende Nichts, das uns jederzeit verschlucken, von Ort und Zeit nehmen könnte. Rassismus in Amerika ist auch hier Thema, doch weniger vordergründig als in den letzten beiden Werken des Autors. Unterm Strich ist Dr. No nicht Everetts bestes Werk – der Thrillerplot droht manchmal etwas aus der Kurve zu kippen, der Schluss überrascht nicht – dennoch ein unterhaltsam-komisches wie spannendes Werk über die zynische Welt, in der wir leben.
*
Dr. No ist bei Hanser erschienen.
Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.