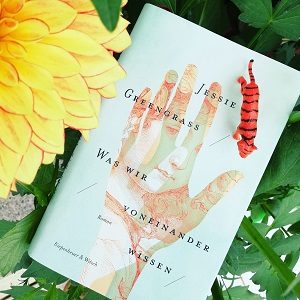 Die Ich-Erzählerin in Jessie Greengrass’ Was wir voneinander wissen begibt sich auf eine Suche nach Erkenntnis, als sie sich die Frage stellt, ob sie mit ihrem Partner Johannes ein Kind empfangen möchte. Sie sucht dabei in ihrer eigenen Familiengeschichte sowie in den Biografien einflussreicher Wissenschaftler. Es ist ein Werk, das den Menschen als Suchenden zeigt, ohne die eine Erkenntnis je greifen zu können.
Die Ich-Erzählerin in Jessie Greengrass’ Was wir voneinander wissen begibt sich auf eine Suche nach Erkenntnis, als sie sich die Frage stellt, ob sie mit ihrem Partner Johannes ein Kind empfangen möchte. Sie sucht dabei in ihrer eigenen Familiengeschichte sowie in den Biografien einflussreicher Wissenschaftler. Es ist ein Werk, das den Menschen als Suchenden zeigt, ohne die eine Erkenntnis je greifen zu können.
Die Frage, ob die Ich-Erzählerin in Was wir voneinander wissen ein Kind bekommen wird, beantwortet der Text bereits auf den ersten Seiten. Tatsächlich ist sie bereits mit dem zweiten schwanger, als Was wir voneinander wissen öffnet. Doch war es die Frage nach dem ersten, die sie aus der Bahn warf und zu einer Reihe Reflexionen über sich selbst und ihrem Verhältnis zur Welt führte. Der nicht chronologisch erzählte Text springt dabei durch die Zeit ihrer eigenen Familiengeschichte, in der die Verhältnisse zur Mutter und zur Großmutter mehr oder weniger stark ausgeleuchtet werden sowie zu großen Denkern, bei denen sie Antworten auf der Suche nach Selbsterkenntnis zu finden hofft: Da wären die Anatomen John und William Hunter, die Menschen sezierten und deren Inneres sichtbar machten, Wilhelm Conrad Röntgen, der ähnliches mit seinen Röntgenstrahlen vollbrachte sowie Sigmund Freud. Ihr Interesse gilt also Persönlichkeiten. die etwas zutage fördern wollten, dass dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleibt.
Die Passagen aus dem Leben der Erzählerin und über das Leben der Wissenschaftler nehmen ähnlich viel Raum ein. Dabei bauen sich immer wieder Assoziationsketten auf, was besonders deutlich wird, als sie sich mit dem Verhältnis ihrer Großmutter – selbst Psychoanalytikerin – und Sigmund Freund und dessen Verhältnis zu seiner Tochter Anna beschäftigt. An anderen Stellen bleiben die Verbindungen eher vage, springen zwischen dem eigenen Erleben und dem Erzählen von den bekannten Wissenschaftlern ebenso wie in der Zeit hin und her. Ähnlich mäandernd sind die Sätze, die Greengrass ihrer Erzählerin mitgibt:
Die Unwiderrufbarkeit der Geburt und alles, was danach käme, erfüllte mich mit Entsetzen, genau wie die Vorstellung, dass die Aufgabe, ein Kind großzuziehen, diese Verantwortung, vor der man sich nicht drücken kann, jede Handlung zu einem folgenschweren Unfall machen, ein anderes Leben verformen könnte, und gefangen zwischen diesen Polen – Wünschen und Fürchten – machte ich nicht nur mir, sondern auch Johannes das Leben schwer (9-10).
Der Inhalt und dessen stilistische Ausgestaltung führen zu der interessanten Frage, um welche Art Text es sich hier eigentlich handelt. Auf dem Buchumschlag ist zu lesen: Roman. Aber seine Struktur deutet eher in Richtung Memoir oder Essay, in dem verschiedenen Lebensstationen mit den Erkenntnissen und Biografien von ähnlich nach Erkenntnis dürstenden Wissenschaftlern miteinander abgewogen werden. Die klassischen Marker der Erzählliteratur fehlen jedenfalls: Was wir voneinander Wissen hat keine Handlung im eigentlich Sinn. Und auch wenn ich die Biografie der Autorin nicht kenne, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Überlegungen ihrer Erzählerin um die eigenen handelt. Doch das hat freilich nur wenig mit der Lesbarkeit des Textes – ob man ihn nun Roman oder Essay nennt – zu tun.
Da die klassischen Konventionen fiktionaler Erzählungen umgangenen werden, ist Was wir voneinander wissen auch kein auf Spannung ausgelegter oder an Stil interessierter Text. Man muss sich schon in die Gedanken der Erzählerin einfühlen können, um sich davon einnehmen zu lassen. Frauen, die sich mit dem Thema Geburt auseinandersetzen, wird dies sicher leichter fallen, als Männern. Ich für meinen Teil habe die Passagen zu Röntgen, Freud und Lumiere mit größerem Genuss gelesen, als jene, die sich um das Leben der Erzählerin drehen. Das liegt auch daran, dass besonders im Hinblick auf das Verhältnis zur Mutter etwas mehr Tiefe und Dringlichkeit wünschenswert gewesen wäre. Denn die Erzählerin muss die schwer erkrankte Mutter lange Zeit pflegen – das Verhältnis von Mutter und Kind kehrt sich gewissermaßen um. Und so berührend es ist, davon zu lesen, bleibt die Mutter im Gegensatz zur Großmutter eine Fremde – als Person ist sie mir nicht greifbar geworden. Gemessen am Titel des Buches bleibt der Text besonders in dieser für die Erzählerin ja auch wichtigen Konstellation etwas unter seinen Möglichkeiten.
*
Was wir voneinander wissen ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.