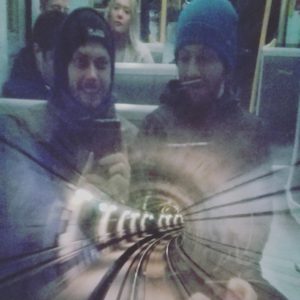 Man kennt das: Nach einer Reise ist man oft so verzaubert, dass man die Magie des Urlaubs möglichst lange lebendig halten will. Manche stellen sich die Wohnung mit Souvenirs voll, andere kochen die Speisen der Urlaubsregion nach und stellen fest, dass es zuhause doch nicht so toll schmeckt. Wer aus Kopenhagen nach Dresden zurückkehrt, verspürt eine andere Art der Urlaubsnostalgie: Fernweh nach der Zukunft, die Heimat erscheint irgendwie unmodern.
Man kennt das: Nach einer Reise ist man oft so verzaubert, dass man die Magie des Urlaubs möglichst lange lebendig halten will. Manche stellen sich die Wohnung mit Souvenirs voll, andere kochen die Speisen der Urlaubsregion nach und stellen fest, dass es zuhause doch nicht so toll schmeckt. Wer aus Kopenhagen nach Dresden zurückkehrt, verspürt eine andere Art der Urlaubsnostalgie: Fernweh nach der Zukunft, die Heimat erscheint irgendwie unmodern.
In Dresden freut man sich über eines der besten öffentlichen Verkehrsnetze des Landes. Engmaschig und überwiegend pünktlich wird man quer durch die Stadt befördert, ohne je mehr als 10 Minuten am Stück laufen zu müssen. „Beste“ ist aber nicht gleich „modernste“: Denn während man ab und an von einem DVB-Bus mit Hybridantrieb von der Straße eingesammelt wird und kürzlich sogar eine eigene App in den PlayStore gebracht wurde, wirken manche Aspekte im Vergleich zu anderen Metropolen etwas gestrig. So kommt es einem zumindest vor, wenn man eben aus Kopenhagen zurückgekehrt ist und sich schon nach einem Tag im Umgang mit den unkompliziert angelegten, öffentlichen Verkehrsmitteln wie ein Einheimischer fühlte.
Die Dinge funktionieren bei unseren nördlichen Nachbarn noch etwas besser, wirken moderner: Abgesehen davon, dass die Orientierung ob der wenigen, aber völlig ausreichenden Linien schnell gefunden ist und an den Bahnhöfen auch bei Verspätungen ziemlich genau angezeigt wird, wann die tatsächliche Abfahrtzeit der S-Bahn ist, gibt es dort noch die 2002 in Betrieb genommene Metro. Anders als viele Dinge, die mit diesem Adjektiv belegt werden, hat sie es tatsächlich verdient: futuristisch. Die Automatisierung hat eben auch ihre Vorteile: So braucht es keine Zugführer mehr und die Metro fährt selbst wochentags im 20-Minutentakt die ganze Nacht (tagsüber alle 6 Minuten). Wer in der ersten Reihe sitzt, fühlt sich wie in einem Fahrgeschäft. Steuerelemente sind hier nur noch aufgemalt. Anders als in Berlin gibt es beim Warten auf die einfahrenden Züge auch keine unterschwellige Angst, von irgendeinem Gestörten auf die Gleise geschmissen zu werden: Der Zugang zu den Gleisen öffnet sich erst, wenn der Zug eingefahren ist und sich dessen Türen öffnen.

Der Fortschritt beginnt aber schon bevor man die Gleise überhaupt betritt. Während man in Dresden oder anderswo in Deutschland noch ziemlich aufgeschmissen ist, wenn man das Geld für die Fahrkarte nicht als Kleingeld parat hat (nicht jede Haltestelle ist mit Fahrkartenautomaten ausgestattet und auch diese akzeptieren nur Bares), verzichten die Verkehrsbetriebe in Kopenhagen weitestgehend auf Papiertickets und überteuerte Tarife für Einzelfahrten (für Touristen gibt es diese freilich noch). Ähnlich wie in Amsterdam reist man hier mit einer Karte (Rejsekort), über die die Fahrtkosten nach Check-in/Check-out-Prinzip abgebucht werden. Wer ein öffentliches Verkehrsmittel besteigt, checkt sich mit der Karte ein. Am Ziel angekommen, checkt man sich wieder aus. Bezahlt wird so nur die tatsächlich zurückgelegte Strecke. Das Guthaben wird bargeldlos aufgeladen.
Überhaupt: In Dänemark ist man drauf und dran, dem Bargeld Lebewohl zu sagen. Hierzulande kommt es, meist in Kiosken, noch vor, dass man die ausgesuchten Produkte aufgrund eines Bargeldmangels an der Kasse liegen lassen muss: „Kartenzahlung erst ab 10 Euro,“ hört man dann, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. In Kopenhagen nimmt selbst der mobile Kaffeeverkäufer auf der Straße Karten aller Art. Hier gibt man sich gleich als Deutscher zu erkennen, wenn man mit der Maestro-Karte in der Hand am Straßengrill fragt, ob bargeldloses Bezahlen denn damit möglich wäre. Selbst neben dem Zapfhahn an der Bar thront ein Kartenlesegerät. Es würde nicht wundern, wenn sogar die (wenigen) Bettler auf der Straße eines hervorzaubern würden. Aber selbst die Maestro- oder Kreditkarte ist auf bestem Weg, von der Zukunft eingeholt zu werden. Selbst die Spätis sind inzwischen mit Möglichkeiten des mobile Payments ausgestattet. Geldausgeben wird einem hier leicht gemacht. Das ist bequem und natürlich auch etwas gefährlich, nimmt es einem doch etwas das Bewusstsein, dass das kleine Bier umgerechnet mehr als vier Euro kostet.
Zurück zur Mobilität abseits der Finanzen: Auch mit eigener Bewegungskraft kommt man gut voran. Zwar haben anders als in Amsterdam die Fahrradfahrer hier noch nicht gänzlich die Herrschaft über das Verkehrsgeschehen übernommen, so kann man als Radfahrer in dieser unseren Autonation nur neidvoll gen Norden schauen, wo man offensichtlich als gleichwertiger Teilnehmer am Straßenverkehr angesehen wird. Es macht ja letztlich auch Sinn, die Bewohner mit hervorragend ausgebauten Wegen zum Fahrradfahren zu ermuntern. Weniger Lärm, mehr Seeluft: In Kopenhagen ist man einfach entspannter unterwegs.
Teil zwei folgt hier!